Die Plus-Gesundheitsinitiative
Gemeinsam gegen Hepatitis C
Die Folgen einer Hepatitis-C-Infektion können gravierend sein. Unbehandelt kann sie zu Leberzirrhose, Leberkrebs, Leberversagen und schließlich zum Tod führen.
Hepatitis C ist heute schnell und einfach heilbar.
Dem gegenüber steht jedoch eine Versorgungssituation, in der viele Menschen mit einer Hepatitis-C-Infektion aus Risikogruppen erschwerten Zugang zu innovativen Therapien haben.
Hepatitis C bis 2030 eliminieren
Sowohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als auch die Bundesregierung haben das Ziel ausgerufen, Hepatitis C bis 2030 zu eliminieren. Um das zu erreichen, braucht es das Engagement von allen. Dabei kommt es auf interdisziplinäre Zusammenarbeit, Bündelung der Kräfte und bedarfsorientierte Angebote für unterschiedliche Patient*innengruppen an.
Gesundheitsversorgung von Risikogruppen nachhaltig verbessern
Dafür setzt sich die PLUS-Gesundheitsinitiative Hepatitis C ein. Die Projekte sind auf die individuellen Bedürfnisse und Lebensumstände einzelner Risikogruppen, z. B. (ehemalig) Drogengebrauchende, Personen in Haft oder Menschen mit Migrationshintergrund, ausgerichtet. Mit dem Fokus auf Hepatitis C ist es das Ziel, auf regionaler Ebene die Gesundheitsversorgung dieser Menschen nachhaltig und strukturell zu verbessern. Kooperation und Vernetzung stehen im Fokus! Regionale Initiativen und Projekte zur HCV-Awareness, niedrigschwelligen Testung und Linkage-to-Care sind dabei ein essentieller Bestandteil.
Ablauf und Hilfe
Am Beispiel von (ehemalig)
Drogengebrauchenden

Der Weg des/der Patient*in in die HCV-Freiheit auf einen Blick
Unterstützung auf dem Eliminations-Weg: Test & Linkage-to-Care-Aktionen
Lokale Test & Linkage-to-Care-Aktionen unterstützen Patient*innen dabei, niedrigschwellig und barrierearm eine mögliche Hepatitis-C-Diagnose aufzudecken und eine anschließende adäquate Anbindung an die Versorgung zu ermöglichen. Die landesweiten Aktionen helfen dabei, Versorgungslücken zu schließen und tragen damit einen Teil zum Hepatitis-C-Eliminationsziel bis 2030 bei.
Plus-Konzept & -Angebote
Das >>mehr<< in der Versorgung
Die PLUS-Gesundheitsinitiative Hepatitis C wurde 2015 gemeinsam vom Caritasverband für Stuttgart e. V., der Deutschen Leberhilfe e. V. und dem BioPharma-Unternehmen AbbVie mit einem ersten Projekt in Stuttgart ins Leben gerufen.
Gestartet mit der Risikogruppe der Drogengebrauchenden, hat sich der Fokus der PLUS-Initiative inzwischen auf Menschen mit Hafterfahrung und Migratonshintergrund erweitert. Die PLUS-Gesundheitsinitiative ist seit ihrer Gründung 2015 schnell gewachsen.
Seit 2023 konzentriert sich PLUS auf lokale, kleine Netzwerkaktionen zur Verbesserung der Versorgungssituation. Im Fokus der Aktionen stehen niedrigschwellige Test & Linkage-to-Care-Aktionen.
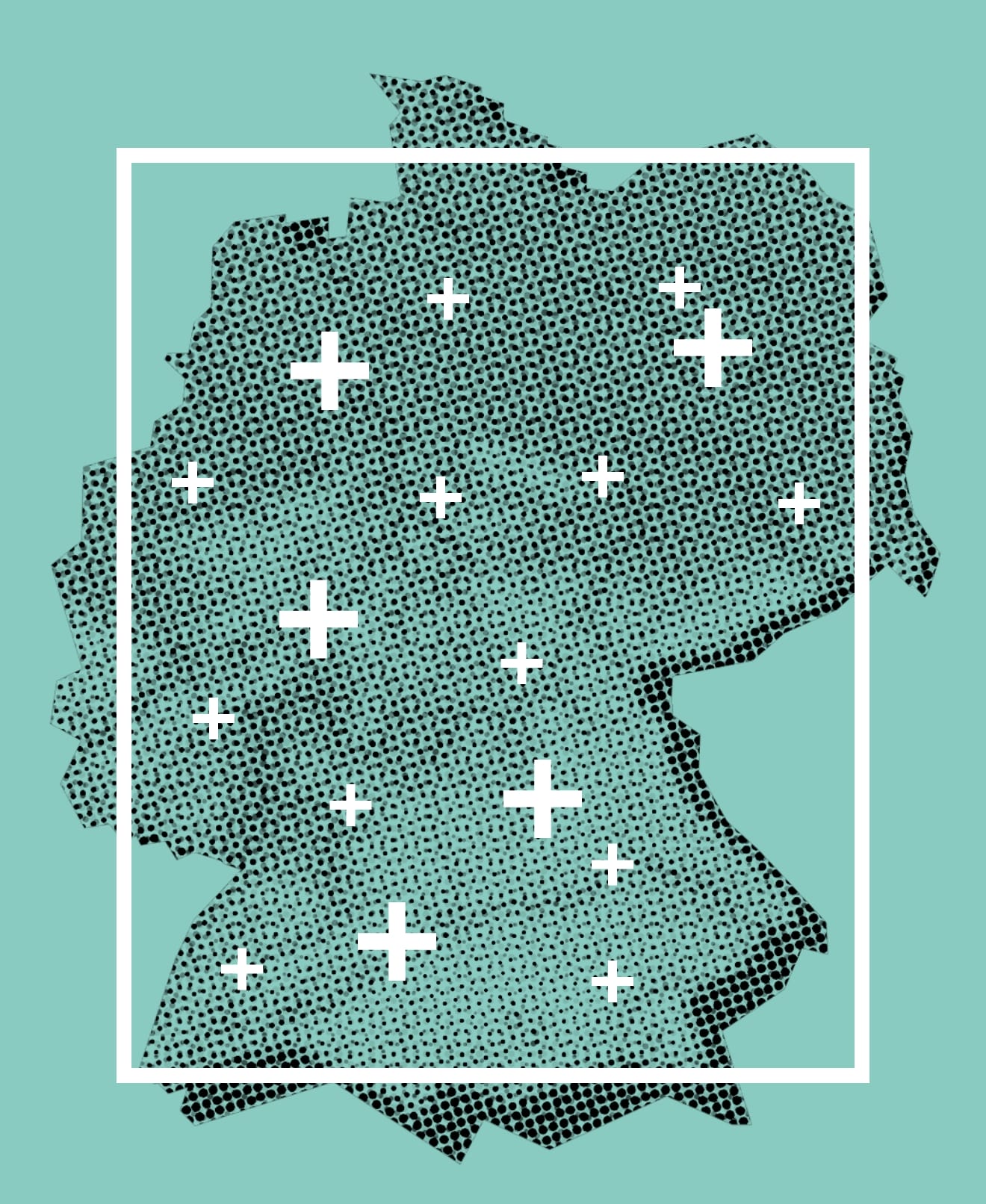
Sie sind ein Verband, Verein oder eine Organisation und möchten ein niedrigschwelliges Angebot in Form einer Test & Linkage-to-Care-Aktion initiieren?
Dann melden Sie sich!
Zielsetzung der Plus-Initiative
Die Bekämpfung von Hepatitis-C
Die PLUS-Initiative verfolgt einen innovativen Ansatz zur Bekämpfung von Hepatitis C.
Mit lokalen Test & Linkage-to-Care-Aktionen wird der Zugang zu gesundheitlicher Versorgung ermöglicht.
Folgende Ziele sind damit verbunden:
Grundsätze der PLUS-Initiative
das >>mehr<< in der Versorgung
Enge und abgestimmte Zusammenarbeit
Die Vernetzung mit Partner*innen aus niedrigschwelligen Einrichtungen spielt innerhalb der Test & Linkage-to-Care- Aktionen eine entscheidene Rolle. Die Einrichtungen und Projektpartner*innen pflegen einen intensiven Austausch mit Ärzten und Ärztinnen vor Ort, um bestehende Versorgungsnetzwerke zu erweitern und neue aufzubauen.
Versorgungsansatz
Durch die PLUS-Initiative sollen vulnerable Gruppen (wie zum Beispiel: Drogenkonsument*innen, Substitutionspatient*innen, Migrant*innen etc.) erreicht werden sowie deren Gesundheitsbewusstsein gestärkt und Gesundheitsversorgung verbessert werden. Die Erreichung des Vorhabens soll durch lokale, niedrigschwellige Test & Linkage-to-Care-Aktionen erfolgen. Der Fokus liegt dabei auf dem Thema Hepatitis C.
Nachhaltige Verbesserung
Die Partner der lokalen PLUS-Aktionen streben eine Verbesserung des Gesundheitsbewusstseins von vulnerablen Gruppen an. Dabei spielt das PLUS Test & Linkage-to-Care- Angebot eine wichtige Rolle. Vulnerable Gruppen können besser versorgt und begleitet werden.
Hepatitis C
Heilbar, aber noch nicht ausreichend behandelt
Hepatitis C wird in der Regel durch den direkten Kontakt von infiziertem Blut mit dem Blut eines anderen Menschen übertragen. Menschen mit Hepatitis C leben häufig über Jahre mit der Erkrankung, ohne es zu wissen, da die Symptome oft unspezifisch sind.
ca. 189.000
MENSCHEN IN DEUTSCHLAND SIND VON CHRONISCHER HEPATITIS C BETROFFEN 1
Auch wenn sie in den ersten Monaten von selbst ausheilen kann, schreitet Hepatitis C meist im Verlauf unbemerkt fort und wird chronisch.
BIS ZU85%
DER HEPATITIS-C-INFEKTIONEN WERDEN CHRONISCH 2
Eine chronische Hepatitis C kann unbehandelt zu Leberschädigungen, Leberzirrhose und bis hin zum Tod führen. Zudem ist sie mit einem erhöhten Risiko für Leberkrebs verknüpft.
60%
DER LEBERZELL



